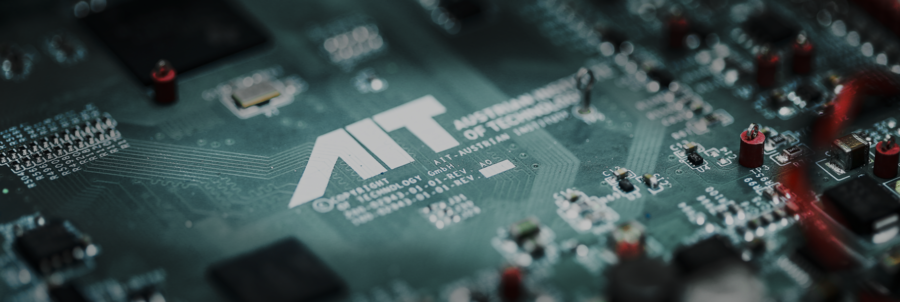Böden sind eine der zentralen Lebensgrundlagen für Ernährung, Klima und Ökosysteme – doch ihr Zustand verschlechtert sich weltweit. In der Fachzeitschrift One Earth wurde nun ein internationales Framework veröffentlicht, das Bodenbiodiversität, Ökosystemleistungen und gesellschaftliche Bedürfnisse systematisch miteinander verknüpft. Mit Beiträgen von Angela Sessitsch, Head of Center Health & Bioresources, und Markus Gorfer, Scientist am AIT, liefert das Konzept eine wissenschaftlich fundierte Basis, um die Bedeutung gesunder Böden für Ernährungssicherheit, Umwelt und menschliche Gesundheit messbar zu machen.
Bedrohung der Bodenbiodiversität
Schätzungen zufolge lebt rund 60 % der globalen Biodiversität im Boden – von Mikroorganismen wie Bakterien und Pilzen bis hin zu Kleintieren wie Nematoden oder Insektenlarven. Sie steuern Nährstoffkreisläufe, sichern die landwirtschaftliche Produktion und tragen wesentlich zur Klimaregulierung bei. Dennoch setzen intensive Nutzung, chemische Belastungen und der Klimawandel diese unterirdische Vielfalt massiv unter Druck. Forschende warnen, dass der Verlust der Bodenbiodiversität nicht nur ökologische, sondern auch direkte Folgen für die Gesundheit der Menschen haben kann – etwa durch geringere Erträge, schlechtere Ernährung oder höhere Anfälligkeit gegenüber Krankheiten.
Neues Framework als Lösungsansatz
Das vorgestellte Soil Biodiversity and Well-being Framework (SBWF) – ein wissenschaftliches Konzeptmodell – schafft erstmals eine übergreifende Architektur, die Bodenressourcen mit ökologischen, ökonomischen und sozialen Indikatoren verbindet. Damit lassen sich die Wechselwirkungen zwischen Bodenzustand, Ökosystemleistungen und gesellschaftlichem Nutzen nachvollziehbar darstellen.
„Wir brauchen ein Instrument, das die enorme Bedeutung der Bodenbiodiversität nicht nur wissenschaftlich beschreibt, sondern auch ökonomisch und gesellschaftlich fassbar macht“, betont Angela Sessitsch. Nur durch eine solche Sichtweise könne nachhaltiges Bodenmanagement in großem Maßstab umgesetzt werden – und so langfristig Ernährungssicherheit und ökologische Stabilität gewährleisten.
Auch Markus Gorfer unterstreicht die praktische Dimension: „Gerade die Interaktion von Mikroorganismen und Pflanzen – bis hin zu pathogenen Pilzen – zeigt, wie sensibel Bodenökosysteme reagieren.“ Ein integratives Framework ermögliche es, diese komplexen Zusammenhänge besser zu verstehen und Risiken für Landwirtschaft und Umwelt frühzeitig zu erkennen.
Kontext der AIT-Expertise
Die Competence Unit Bioresources am AIT erforscht seit vielen Jahren die Rolle von Mikroorganismen in landwirtschaftlichen und natürlichen Systemen. Mit molekularbiologischen Methoden und mikrobiellen Datenbanken trägt sie dazu bei, die Funktionsweise komplexer Ökosysteme sichtbar zu machen. Das neue Framework fügt sich nahtlos in diesen Kontext ein, da es naturwissenschaftliche Erkenntnisse mit Bewertungsmodellen und politischen Instrumenten verbindet.
Die Operationalisierung des Frameworks eröffnet vielfältige Möglichkeiten: von der Entwicklung belastbarer Indikatoren für Bodenpolitik über die Einbindung von Landwirten in Monitoring-Systeme bis hin zur Nutzung von KI-gestützten Modellen für Ursachen-Wirkungs-Analysen. Damit entsteht eine wissenschaftliche Grundlage, um Böden als natürliche Ressource langfristig zu sichern und ihren Beitrag zu Ernährung, Gesundheit und gesellschaftlicher Resilienz stärker zu berücksichtigen.