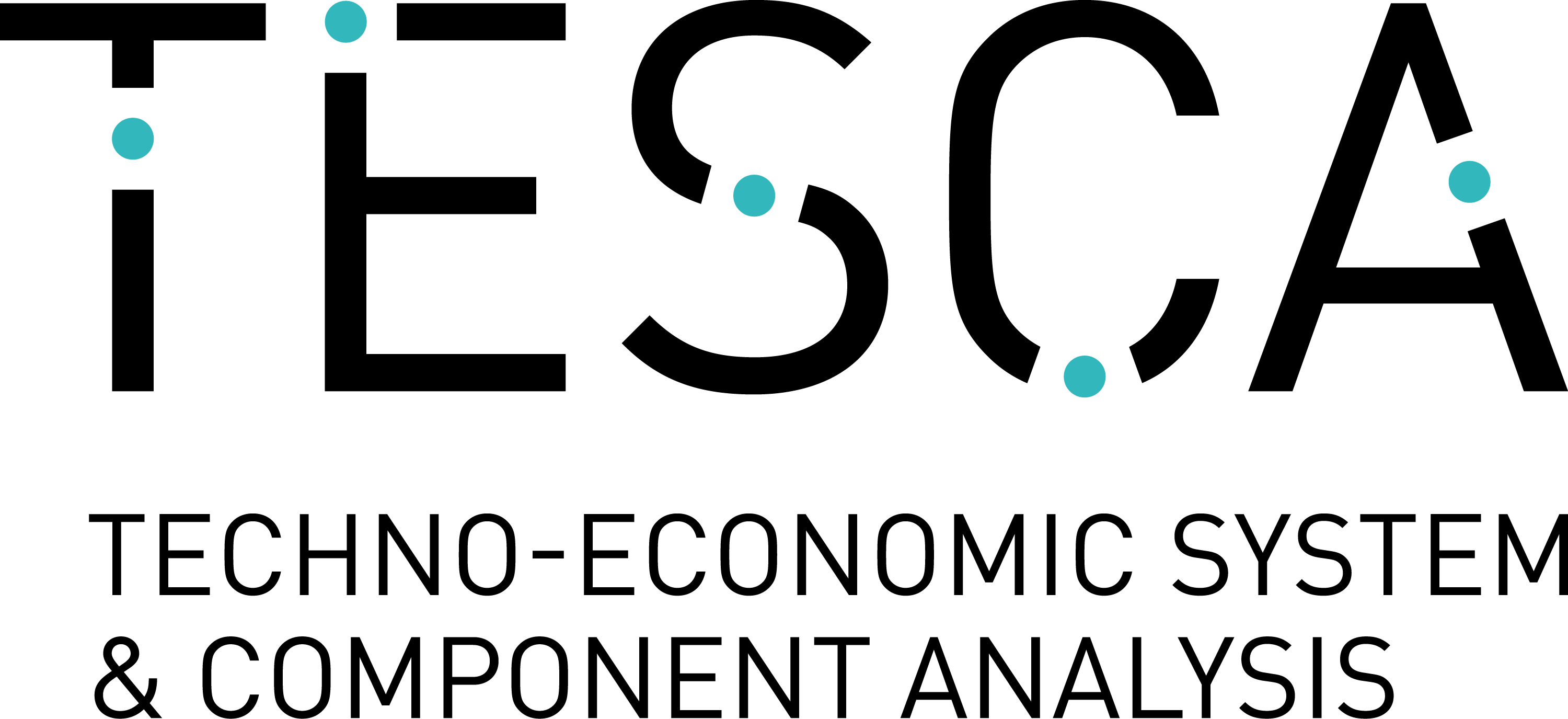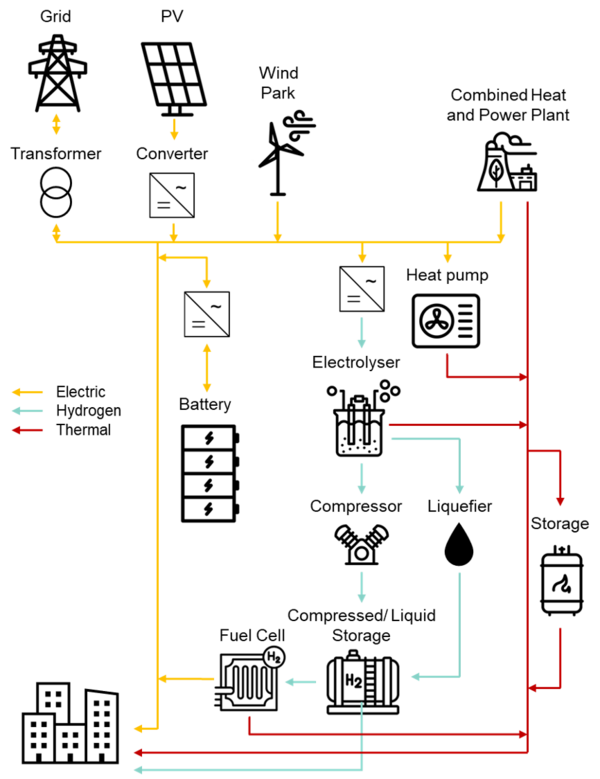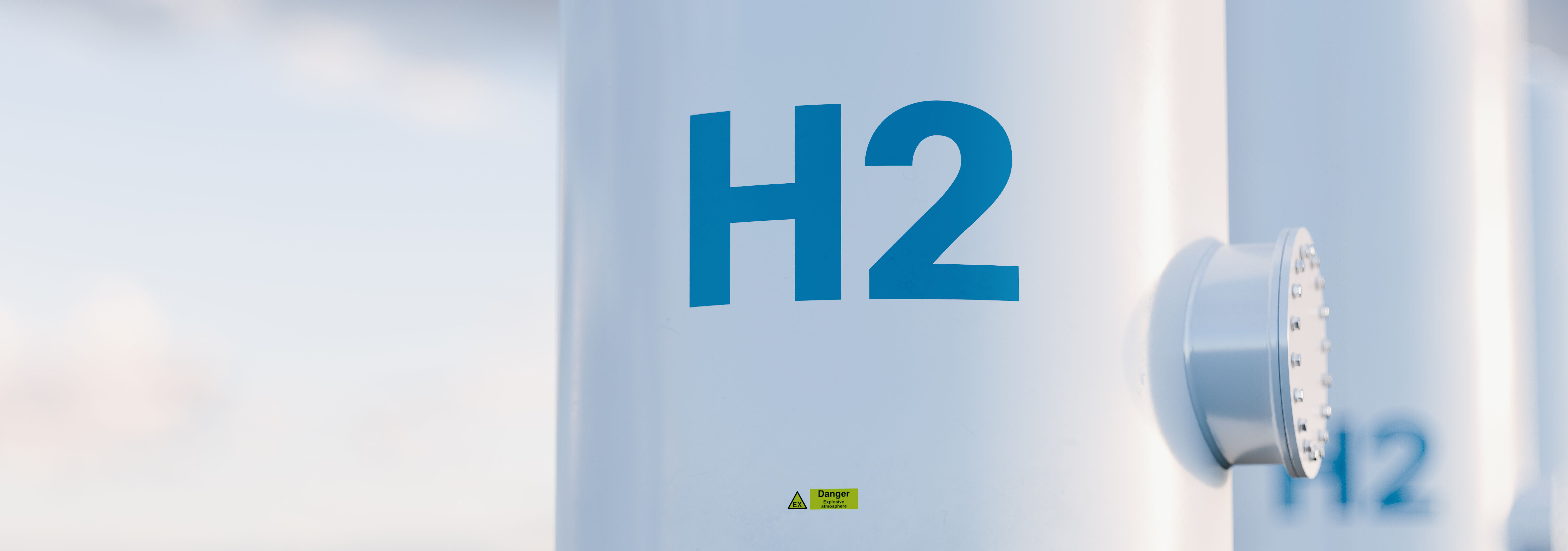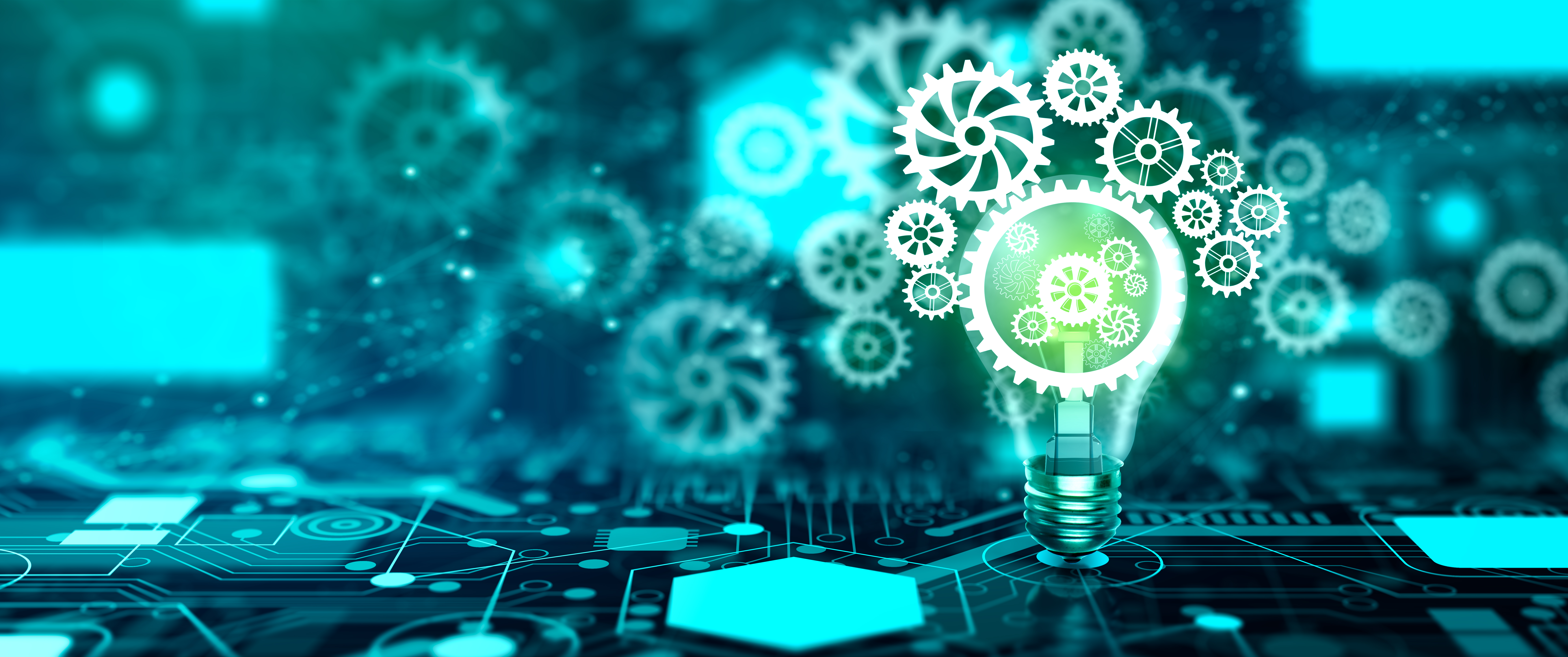Im Rahmen der nachfolgenden Analysen wird ein ganzheitlicher, wirtschaftlicher, Ansatz zur Dekarbonisierung von Energiesystemen verfolgt, mit besonderem Fokus auf die Sektoren Strom, Wasserstoff, thermische Energie und Mobilität. Ziel ist es, Potenziale für eine wirtschaftliche, nachhaltige und resiliente Versorgung durch den intelligenten Einsatz erneuerbarer Energien, Speicherlösungen und Flexibilitäten zu identifizieren und fundierte Entscheidungsgrundlagen für konkrete Projekte zu schaffen.
Grundlage der Untersuchungen bildet die detaillierte Analyse der standortspezifischen Rahmenbedingungen. Je nach Projekt und wissenschaftlichen Fragestellungen kann dies unter anderem Netzanschlussmöglichkeiten, Infrastruktur für Strom und Gas sowie Wasserstoff betreffen. Darauf aufbauend können bestehende Lastprofile (Strom, Wasserstoff, Erdgas, thermische Energie) inklusive möglicher Flexibilitäten ermittelt werden. Eine zentrale Rolle spielt meist die Analyse der Erzeugungspotentiale aus Photovoltaik und Wind, inklusive der resultierenden zeitaufgelösten Erzeugungsprofile. Weiters kann ein Vergleich von Erzeugungs- und Verbrauchsprofilen die Basis für die Dimensionierung notwendiger Speicher- oder Flexibilitätsoptionen bilden.
Das Technologieportfolio von TESCA ist im folgenden Diagramm dargestellt:
Wirtschaftlicher Betrieb & Vermarktung von Batteriespeichern
Ziel dieses Projekts ist die wirtschaftliche Bewertung und Optimierung des Betriebs von Batteriespeichersystemen unter Berücksichtigung verschiedener Vermarktungsstrategien und technischer Betriebsparameter. Zu diesem Zweck wird TESCA mit dem ebenfalls am AIT entwickelten Optimierungsframework IESopt kombiniert, welches unter anderem eine Abbildung der (Strom-)Märkte beinhaltet. Im Fokus steht bei diesem Projekt die bestmögliche Systemkonfiguration unter den gegebenen Rahmenbedingungen, um den finanziellen Gewinn zu maximieren.
Untersucht werden sowohl Standalone-Batteriespeicher (ohne direkte Kopplung an Erzeugungs- oder Verbrauchsanlagen) als auch Batteriesysteme, die gemeinsam mit erneuerbarer Erzeugung und spezifischen Stromlastprofilen betrieben werden. Für beide Ansätze werden unterschiedliche Vermarktungsoptionen analysiert, insbesondere die Teilnahme an Intraday-Märkten, im Day-Ahead-Handel sowie die Erbringung von Regelenergie-Dienstleistungen.
Zur Bewertung der Wirtschaftlichkeit werden zentrale betriebswirtschaftliche Kennzahlen herangezogen, darunter der Net Present Value, der Return on Investment sowie die Amortisationszeit der jeweiligen Batteriespeicherkonfiguration. Ergänzend werden technische Parameter wie Zyklenlebensdauer und die zu erwartende Betriebsdauer bis zum End of Life in die Analyse einbezogen, um eine realistische Einschätzung der langfristigen Wirtschaftlichkeit und Betriebsfähigkeit zu gewährleisten.
Durch den Vergleich unterschiedlicher Betriebs- und Vermarktungsszenarien werden belastbare Entscheidungsgrundlagen für Investoren, Betreiber und Energieversorger geschaffen, um Batteriespeicher sowohl technisch als auch wirtschaftlich optimal in das Energiesystem zu integrieren.
Konkrete Themen aus den Projekten:
- Batteriespeicherauslegung für die Vermarktung am Intraday-, oder Day-Ahead-Markt
- Batteriespeicherauslegung für die Vermarktung am Regelenergiemarkt
- Vergleich und Analyse von Standalone Batteriespeichern mit PV-gekoppelten Batteriespeichern, und/ oder Lastgekoppelt.
Wasserstoffproduktion und -nutzung
Ziel dieser Art von Projekten ist es, eine technische und ökonomisch realisierbare Wasserstoffversorgung sicherzustellen – sowohl durch lokale Produktion aus erneuerbaren Energiequellen als auch durch alternative Versorgungswege. Dazu zählen:
- Lokale H2 Produktion basierend auf erneuerbarer Energie-Erzeugung vor Ort
- Strom-Zukauf und lokale H2 Erzeugung
Alternativ zur lokalen Deckung des benötigten Strombedarfs, werden alternative Versorgungspfade in der näheren Umgebung untersucht, beispielsweise über Power Purchase Agreements bzw. durch Direktanschluss an nahegelegene Erzeugungsanlagen. Hierbei fließen Infrastrukturkosten (Leitungen, Strompreise, Netzentgelte) in die LCOH-Berechnung ein. - H2-Zukauf
Weiters kann ein H2-Zukauf innerhalb Österreichs oder international erfolgen. Dies umfasst die Betrachtung der LCOH am Produktionsstandort sowie der Kosten für Transport (Pipeline, LKW, Schiff, etc.), Umwandlung in Wasserstoffderivate (z. B. Ammoniak, LOHC) und Rückumwandlung am Zielort, um ein realistisches Bild der Endkosten beim Verbraucher zu erhalten.
Anhand der Ergebnisse können konkrete Handlungsempfehlungen für eine nachhaltige Wasserstoffstrategie erarbeitet werden, die den spezifischen Bedarf, technische Möglichkeiten und wirtschaftliche Rahmenbedingungen berücksichtigen.
Im Rahmen der Projekte zur Wasserstoffproduktion und -nutzung können auch unterschiedliche Technologien systematisch analysiert und miteinander verglichen werden. In bisherigen Arbeiten wurden beispielsweise AEL-Elektrolyseure und PEM-Elektrolyseure sowohl qualitativ als auch quantitativ bewertet. Im Projekt H2Heat wurde weiters die potentielle Nutzung der Abwärme dieser Elektrolyseurtypen analysiert. In dem Projekt HyEmpire wird der Vergleich zwischen konventionellen mechanischen Wasserstoffkompressoren und elektrochemischen Kompressoren durchgeführt. Weiters wird in dem Projekt HyDestiny zurzeit die Bewertung unterschiedlicher Wasserstoffspeichertechnologien hinsichtlich technischer und wirtschaftlicher Kriterien analysiert.
Ziel ist es, die jeweiligen Vor- und Nachteile der Technologien herauszuarbeiten – insbesondere im Hinblick auf ihre Integration in Systeme mit erneuerbaren Energien, ihr Verhalten bei schnellen Laständerungen und ihre Regelgeschwindigkeit sowie hinsichtlich Effizienz, Betriebskosten, Wartungsaufwand, technologischer Reife und Skalierbarkeit. Durch den technischen und wirtschaftlichen Vergleich bestehender Technologien mit neuen Ansätzen sollen fundierte Entscheidungsgrundlagen geschaffen werden, um für unterschiedliche Anwendungsfälle die jeweils optimale Lösung identifizieren zu können.
Konkrete Themen aus den Projekten:
- Wasserstoffproduktion und direkte Versorgung lokaler Kunden.
- Gestaltung der lokalen Versorgung großer Verbraucher mit Wasserstoff (Schiff, Bahn, öffentlicher Verkehr) in Kombination mit Wind- und PV-Anlagen.
- Analyse des Potentials für die Produktion und den Import von grünem Wasserstoff in verschiedenen Ländern.
Projekte
Design und Planung von Energielösungen
Ziel dieses Projekts ist es, maßgeschneiderte, wirtschaftlich tragfähige und technisch robuste Energielösungen zu entwickeln, die erneuerbare Energiequellen, Speichertechnologien und flexible Verbraucher optimal miteinander verknüpfen. Dabei werden sowohl einzelne Verbraucher als auch Energiegemeinschaften oder regionale Energiesysteme betrachtet. Durch intelligente Systemgestaltung sollen Eigenverbrauch, Versorgungssicherheit, Netzstabilität und Wirtschaftlichkeit gleichermaßen verbessert werden.
Um dieses Ziel zu erreichen, wird zunächst eine detaillierte Analyse der individuellen Strom-, Erdgas-, Wärme- und Wasserstoff-Bedarfsprofile durchgeführt. Bei Bedarf werden mehrere Profile aggregiert, um gemeinsame Verbrauchsmuster zu identifizieren. Parallel erfolgt die Modellierung verschiedener erneuerbarer Erzeugungsprofile.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der technischen Auslegung des Gesamtsystems: Hierzu zählt die Bewertung bestehender Speicherinfrastrukturen und flexibler Lasten hinsichtlich ihres Beitrags zur Eigenverbrauchsoptimierung, zur Deckung von Spitzenlasten und zur Netzunterstützung. Weiters ist die Bestimmung der erforderlichen zusätzlichen Speicherkapazitäten, die Auswahl der jeweils passenden erneuerbaren Erzeugungstechnologien sowie die Planung der optimalen Systemarchitektur für eine sichere, effiziente und nachhaltige Energieversorgung wesentlich.
Aufbauend auf diesen Analysen kann die Konzeption von Energiegemeinschaften, Energiezellen oder Energy Valleys erfolgen. Optional können Stromnetzsimulationen eingebunden werden, um z. B. stationäre Batteriespeicher oder Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge auch netzdienlich auszulegen.
Abschließend werden die entwickelten Systemvarianten einem techno-ökonomischen Vergleich unterzogen. Bewertet werden dabei unter anderem verschiedene Speicherlösungen (Batterie, Wasserstoff, etc.) sowie hybride Netzlösungen (z. B. AC/DC-Kombinationen wie im Projekt NEFI ADC Pilot Factory) – jeweils unter Berücksichtigung von Investitions-, Betriebs- und Netzanschlusskosten.
Das Ergebnis sind belastbare Entscheidungsgrundlagen für resiliente, wirtschaftlich effiziente und nachhaltige Energiesysteme, die optimal an die jeweiligen Anforderungen angepasst sind.
Konkrete Themen aus den Projekten:
- Entwicklung von PV-Heimspeichersystemen für Spitzenlastkappung, dynamische Energiepreise und Notstromversorgung.
- Planung und Gestaltung von Energiegemeinschaften unter Berücksichtigung von PV, Wärmepumpen, Batteriespeichersystemen, Elektromobilität etc.
- Entwicklung von DC- und hybriden AC-DC-Netzen für ein modulares, resilientes Netz mit hohem Anteil an erneuerbarer Energieerzeugung.
Projekte
Integration erneuerbarer Energien und Verwertung von überschüssiger Energie
Ziel ist die effiziente Integration erneuerbarer Energiequellen sowie die Verwertung überschüssiger Erzeugung durch die Entwicklung und Bewertung geeigneter Systemerweiterungen. Im Fokus kann dabei die standortspezifische Analyse und Optimierung von Photovoltaik- und Windkraftanlagen in Kombination mit verschiedenen Vermarktungs- und Konvertierungsoptionen stehen.
Im ersten Schritt werden erneuerbare Erzeugungsprofile für spezifische Standorte auf Basis von Wetterdaten erstellt. Dabei fließen technische Parameter wie PV-Moduldaten, Aufständerung, Ausrichtung und Verschattung ebenso ein wie Windprofile, Turbinentypen, Leistungskurven, Nabenhöhe und Rotorfläche. Zur Extrapolation der Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe wird der jeweilige Rauhigkeitsfaktor berücksichtigt, ebenso wie die Windabschattung innerhalb von Windparks.
Die Analyse der Standortbedingungen umfasst die Prüfung der Netzanschlusskapazitäten sowie das Potenzial lokaler Abnehmer. Aufbauend auf diesen Grundlagen können verschiedene Systemverbesserungen untersucht werden, darunter Vermarktungsoptionen wie Day-Ahead-Markt, Intraday-Markt und Power Purchase Agreements, wozu wiederum das Optimierungsframework IESopt herangezogen wird. Auch netzunterstützende Maßnahmen wie Spitzenlastreduktion und Regelenergie können betrachtet werden.
Zur Nutzung überschüssiger Erzeugung werden üblicherweise unterschiedliche Speicher- und sektorübergreifende Verwertungsoptionen analysiert, z. B. Batteriespeicher, Wasserstoff- und Power-to-Heat Anwendungen. Abschließend erfolgt ein technischer und wirtschaftlicher Vergleich der untersuchten Szenarien hinsichtlich Effizienz und Effektivität, um optimale Lösungsansätze für die Integration erneuerbarer Energien auf lokaler Ebene zu identifizieren.
Konkrete Themen aus den Projekten:
- Nutzung überschüssiger Energie von Windkraftanlagen mit Batteriespeichersystemen, P2H-Systemen und thermischen Speichersystemen.
- Energieausgleich und Spitzenlastreduktion von PV-Systemen mit Batterien für großflächige Prosumer.
- Marktbasiertes Einsatzoptimierung von Batteriesystemen in Kombination mit PV und Spitzenlastreduktion.
Projekte
Großverbraucher und Industrie
Ziel dieses Projekts ist es, konkrete und wirtschaftlich tragfähige Dekarbonisierungsstrategien für industrielle Energieverbräuche zu entwickeln. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie fossile Energieträger – insbesondere Erdgas – durch erneuerbare Alternativen wie Strom oder Wasserstoff ersetzt werden können, ohne dabei Versorgungssicherheit, Produktionsqualität oder Wettbewerbsfähigkeit zu gefährden.
Um dieses Ziel zu erreichen, erfolgt zunächst eine umfassende Analyse der industriellen Energieverbräuche, differenziert nach Strom, thermischer Energie und Gasbedarf. Besonderes Augenmerk liegt auf den prozessspezifischen Anforderungen wie Temperaturniveaus, Druckverhältnissen und chemischen Eigenschaften, die für den sinnvollen Einsatz alternativer Energieträger entscheidend sind.
Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die Analyse von saisonalen Schwankungen, betrieblichen Flexibilitäten sowie der Notwendigkeit von Ausfalls- und Langzeitspeichern. Ziel ist es, Lösungen zu identifizieren, die eine stabile Energieversorgung auch bei volatiler Erzeugung durch erneuerbare Energien gewährleisten.
Darauf aufbauend können Versorgungsstrategien für eine klimaneutrale Zukunft entwickelt werden. Zentrale Fragestellungen sind:
- Ist eine Eigenproduktion der benötigten Energie am Industriestandort wirtschaftlich und technisch sinnvoll? (z. B. PV, Wind, Elektrolyse für H₂-Produktion)
- Oder sind alternative Beschaffungswege wie Power Purchase Agreements oder der Bezug über den europäischen Hydrogen Backbone vorteilhafter?
Im Rahmen des Projekts können alle Optionen hinsichtlich technischer Machbarkeit, wirtschaftlicher Tragfähigkeit und Versorgungssicherheit bewertet werden. Ergebnisse sind zum Beispiel standortspezifische Empfehlungen , die Unternehmen als fundierte Grundlage für den Umstieg auf eine klimaneutrale Energieversorgung dienen können.
Konkrete Themen aus den Projekten:
- Gestaltung der Energieversorgung für große Verbraucher mit Schwerpunkt auf Wasserstoff und erneuerbaren Energien.
Projekte
Mobilitätsanwendungen
Ziel dieses Projektes ist es, den Mobilitätssektor schrittweise zu dekarbonisieren und dafür praxistaugliche, wirtschaftliche und technologisch sinnvolle Lösungen zu identifizieren. Im Fokus steht dabei die Frage, unter welchen Bedingungen batterieelektrische Antriebe oder Wasserstofftechnologien eine nachhaltige Alternative zu fossilen Energieträgern wie Diesel, Benzin, Erdgas oder Kerosin darstellen. Betrachtet wurden bisher insbesondere öffentliche Verkehrsmittel (Bus & Bahn), sowie die Seenschifffahrt und Kurz- bis Mittelstreckenflugzeuge.
Zu Beginn erfolgt eine umfassende Analyse der bestehenden Mobilitätsstrukturen. Dabei werden Fahrstrecken, Fahrpläne, Haltestellen, Fahrpausen und mögliche Nachlademöglichkeiten detailliert erhoben. Aufbauend darauf werden aktuelle Verbräuche fossiler Energieträger erfasst und bewertet.
Ein weiterer Bestandteil kann die Analyse von Flexibilitätspotenzialen innerhalb der Ladeprofile sein, sowie der Identifikation von möglichen Rekuperationspotenzialen, um die Effizienz der künftigen Antriebssysteme weiter zu steigern. Ziel ist es, herauszuarbeiten, in welchen Anwendungsfällen welche alternativen Antriebe den täglichen Energiebedarf vollständig decken können, insbesondere bei langen Strecken, saisonalen Schwankungen oder spezifischen Transportaufgaben.
Ergänzend werden Bedarfsprojektionen für die kommenden Jahre erstellt, insbesondere für den Einsatz in Schiffen, Bussen und im Kurz- bis Mittelstreckenflugverkehr, um zukünftige Entwicklungen und Anforderungen in die Bewertung einfließen zu lassen.
Parallel kann das lokale Potenzial für die Erzeugung erneuerbarer Energien (Photovoltaik, Windkraft) analysiert werden. Dabei wird geprüft, ob der Energiebedarf durch lokale Erzeugung in Kombination mit Speichern gedeckt werden kann oder ob zusätzliche Mengen aus dem Stromnetz erforderlich sind.
Die Ergebnisse sollen fundierte Entscheidungsgrundlagen für eine nachhaltige Transformation von Mobilitätssystemen liefern. Die Projekte sollen aufzeigen, welche Technologien in welchen Anwendungen sinnvoll eingesetzt werden können und wie sich diese technisch und wirtschaftlich optimal integrieren lassen.
Konkrete Themen aus den Projekten:
- Dekarbonisierung des Mobilitätssektors
- Batteriespeichersysteme für Spitzenlastreduktion in der E-Mobilität.
- Auslegung der Infrastruktur für alternative Antriebe